
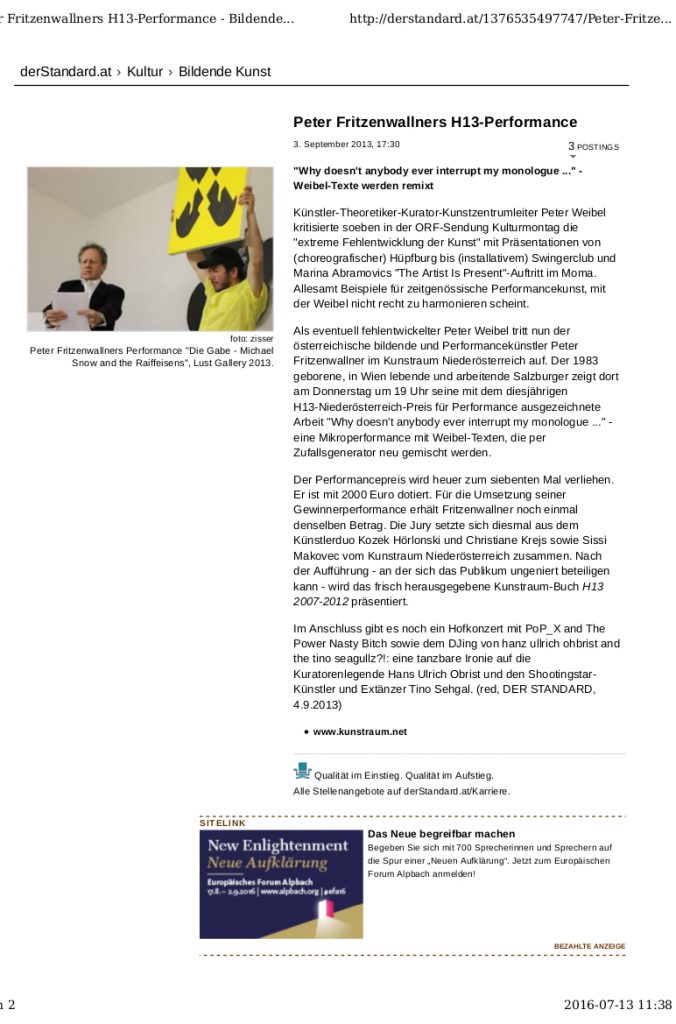
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Performance-Künstler Peter Fritzenwallner im Porträt
Performancekünstler haben es am Kunstmarkt naturgemäß schwer, schaffen sie doch keine verkäuflichen Kunstobjekte, sondern Arbeiten, die flüchtig und immateriell sind. Um junge Performancekünstler zu unterstützen vergibt der Kunstraum Niederösterreich seit 2007 den H13, den Niederösterreich Preis für Performance.

Das öffentliche und gemeinsame Vortragen diverser Formen, aus den Bildern von schon fast vergessenen Malern, durch junge Leute von heute, die auch gerne malen, aber eben nicht nur. performance von peter Fritzenwallner in Wien, Mai 2012.
Kulturjournal, 02.09.2013
In diesem Jahr wurde der 30- jährige Salzburger Peter Fritzenwallner ausgezeichnet, der ursprünglich aus der Malerei kommt. Fritzenwallner hat in den vergangenen Jahren mit Performances auf sich aufmerksam gemacht, die mit ihrer improvisatorischen Offenheit sowie einer Portion absurdem Humor bestechen.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Der Schlaf der Vernunft gebiert… Malerei
Rolf Wienkötter, 20.06.07
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Die als „Museum auf Abruf“ bekannte Kunstsammlung der Stadt Wien meldet sich machtvoll zurück, mit neuen Räumlichkeiten und einem von Iara Boubnova kuratierten Sammlungsquerschnitt. Einer guten Tradition der Nachwuchspflege folgend ist auch Raum für die Einzelpräsentation eines jungen Künstlers: Peter Fritzenwallner macht den Anfang, laut Eigendefinition Maler, allerdings einer, der zu Ergebnissen kommt, die mit der momentanen Bilderflut erfreulich wenig zu tun haben. Was wir sehen, ist eine Bild, Zeichnung, Objekt und Video gewordene Grübelei über das, was Malerei an sich bedeuten könnte, besonders für den Maler selbst. Aber keine Angst, es wird nicht zum x-ten Mal dekonstruiert, was wir ohnehin schon alle durchschaut haben: Fritzenwallners Kunst ist amüsant und lustbetont, ohne zu unterfordern.
Doch was ist zu sehen? „Kopien“ alter Meister, seltsam lässig gemalt, wie unvollendet, darunter Giorgiones „Laura“ und Rubens` „Mädchen mit Fächer“ aus dem Kunsthistorischen Museum, letzteres auf einer Staffelei stehend, die zu einem grotesken Apparat erweitert wurde (eine Art Katapult fällt auf), mit einem umgebauten Ikea-Möbelstück und einem Staubsauger in Verbindung stehend. An den Wänden Tableaus mit Zeichnungen, welche die typischen Ikea-Anleitungen aufnehmen und bearbeiten. Das eigentliche Kraftzentrum sind die Videos, v.a. „Three Rooms“ von 2007: hier wird das Netz ausgelegt, das die gezeigten Dinge beseelt und zu Akteuren in einem eigenartigen Schauspiel werden lässt. Die Frau als Motiv, Muse, Objekt einer männlich-kreativen Potenz, das Kunstwerk als sublimierter Geschlechtsakt, das ist das nicht unheikle Terrain, auf dem sich Fritzenwallner bewegt. Was wir sehen, ist aber keine ideologiekritische Pflichtübung, sondern ein traumwandlerischer Parcours, der selbstironische, humorvolle und poetische Momente in eine feine, doch sehr präzise Balance bringt. Das Video führt die Stränge zusammen, hat keine Scheu vor den Suggestivmethoden des Kinos, erzeugt einen narrativen Sog, ohne den absurd-versponnenen Grundton zu verraten. Die Malerei wird zur Selbstbegattung, die Staffelei zur „Junggesellenmaschine“ („AUTist“ steht auf einer der Zeichnungen). Künstler und Werk sind in einem Stoffwechselkreislauf von Ernährung, Verdauung, Kopulation und Ejakulation verfangen, und das Hochgeistig-Kulturelle ist untertunnelt von den Impulsen unserer biologischen Existenz. KHM, Ikea und Künstleratelier, Geschichte und Gegenwart treffen sich in der Tiefe, dort, wo sich der Körper regt und räkelt.
Klarerweise fühlt man sich an so manches erinnert. Wer aber dieses Grundproblem wohl jeden künstlerischen Anfangs so unterhaltsam und unerschrocken beackert und daraus eine ganz eigene Empfindsamkeit zu formen versteht, wie etwa Fritzenwallners Video „Bohemian Mass“ demonstriert, hat alle Sympathien verdient – und viele Besucher.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kunstwandern: Schritt für Schritt
Die Kunst ist dabei, eine der ältesten Fortbewegungsarten wiederzuentdecken: Das Gehen.
(Die Presse – Schaufenster)
Es ist einer dieser besonders schönen Herbsttage, als sich vor dem Bad Kleinkirchner Hallenbad rund 200 Menschen zum „Kunst-Wandern“ einfinden. „Public Art Walk mit Hamish Fulton“ heißt die Veranstaltung zum Start des „nock/art-Festivals“. Obwohl sie nur für eine Stunde anberaumt ist, sind die Teilnehmer gut ausgerüstet. Viele tragen Wanderschuhe, einige auch Hightech-Funktionskleidung. Man kann ja nie wissen . . . Um 10.15 Uhr tritt der Künstler vor die Menge und erklärt den Ablauf: In sechzig Minuten soll eine 300 Meter lange Strecke zurückgelegt werden. Nicht mehr, nichts sonst. Die Menge wird in zwei Gruppen geteilt und soll sich von zwei unabhängigen Punkten in einer regelmäßigen Einerreihe gegenläufig aufeinander zubewegen, um anschließend den Ausgangspunkt der jeweils anderen Gruppe anzusteuern.
Die erstaunte Reaktion der Teilnehmer über die Kürze der Strecke, die langsame Gehgeschwindigkeit, ist dem britischen Künstler nicht fremd. „Sie fragen sich vielleicht“, fährt er fort, „warum soll man das tun? Wann habe ich so etwas das letzte Mal gemacht? Nun, es gibt kein letztes Mal. Es geht darum, dass Sie es noch nie getan haben und dass dieses Mal das erste Mal sein wird. Es geht um die Erfahrung. Vielleicht fragen Sie sich auch: Ist das Kunst? Nun, ich bin Geh-Künstler, das ist die Art von Kunst, die mich interessiert. Wir gehen und bauen auf diese Weise gemeinsam eine Erfahrung, kein Objekt. Das Kunstwerk, das entsteht, besteht aus Menschen.“
Mehr als Land-Art. Für Hamish Fulton (Jahrgang 1946), eine der Schlüsselfiguren der internationalen Konzeptkunst, ist Gehen seit langem ein zentraler Bestandteil seiner Kunst. Natur und die Bewegung in ihr spielt da eine zentrale Rolle. Die Verbindung mit der Land-Art, die ihre hauptsächliche Ausprägung im skulpturalen Objekt findet, greift aber zu kurz. So meditativ und ästhetisch Fultons Aktionen auch erscheinen: Bei ihm geht es stets auch um die Mitwirkung und Teilhabe der Teilnehmer manchmal auch um eine politische Geste, etwa beim „Slowalk (In support of Ai Weiwei)“ für die Freiheit der Kunst. Mit seinen Walks rührt Fulton an einen Nerv der Zeit, der sich im aktuellen Kunstgeschehen widerspiegelt. Zwar ist das Gehen vor allem seit der wechselseitigen Durchdringung der bildenden und performativen Künste in den 1970ern zum eigenen künstlerischen Formelement geworden. Man denke etwa an die Aktionen des Rumänen Andr Cadere (1934 78), der mit einem bemalten Stock durch die Straßen und Galerien von Paris wanderte, so dass seine Kunst gar keine Ausstellungen brauchte. Oder an die dreimonatige Performance „Great Wall Walk“ von Marina Abramovi & Ulay, mit der das Künstlerpaar 1988 seine private Trennung besiegelte. Auch die Arbeiten von Janet Cardiff & Georges Bures Miller zählen dazu, z. B. ihr „Video Walk“ auf der documenta 2012, bei dem sie das Publikum mit iPod und Kopfhörern auf eine Wanderung durch Raum und Zeit schickten.
Inspiriert von abgeschiedenen Gebieten. Eine eigene Renaissance erlebt das Gehen in der jüngeren Generation. Zumal die heimische Szene zeigt hier stark auf. Michael Höpfner etwa (Jahrgang 1968) entwickelt seine Kunst aus meist mehrmonatigen Wanderungen durch oft unbekannte, abgeschiedene Gebiete. Das Gehen sei für ihn „ein Werkzeug, um die Umwelt auf sehr direktem Weg zu erfassen“. „Künstlerische Arbeit in der Landschaft, die Verbindung von Umwelt und menschlichen Aktivitiäten, ökologische und sozio-politische Realitäten das verhandelt die Kunst seit den 1990ern“, beschreibt er diese „Environmental Art“. „Begriffe wie Land-Art, Arte Povera passen da nicht mehr.“
Vorlage für die bis zu sechsstündigen Geh-Performances des Salzburger Shooting-Stars Peter Fritzenwallner sind Demonstrationen, die er radikal ihres politischen Sinns entleert. „Das Gehen im Kollektiv ist für mich eine institutionelle Praxis. Durch die Entleerung des Mediums bekommt es einen absurden Beigeschmack.“ Ausgehend von urbanistischen, künstlerischen oder literarischen Inhalten werden Sinnlosigkeit, Ortlosigkeit und Nutzlosigkeit zu Triggern, um Stimmungen zu produzieren.
Wahrnehmung ist die zentrale Kategorie für die Stadtperformances von Oliver Hangl, für die er die Teilnehmer mit Kopfhörern ausstattet, um mit ihnen anschließend durch die Straßen zu ziehen, oft bis zu fünf Stunden lang. „Die Realität“, sagt er, „ist mein künstlerisches Aktionsfeld ein Setting, das ich nicht kontrollieren kann und in dem oft unvorhergesehene Dinge passieren. Die Kopfhörer eröffnen da einen ganz eigenen Wahrnehmungsraum. Je länger es dauert, um so mehr bist du in dir. Das ist wie ein Trip.“
Das Gehen als Möglichkeit der Rezeption ist auch Ausgangspunkt der kuratorischen Praxis des Ausstellungsmachers und Kritikers Vitus H. Weh. Es bildet die Grundlage für die Themen-Passagen im Museumsquartier: „Wie in den alten Gemäldegalerien geht es mir um eine Wahrnehmung im Gehen, radikal gesprochen im Vorbei-Gehen: Man taucht ein in eine Vorstellungswelt, geht hinein und wieder heraus. Diese spezielle Erfahrung, wo man sich wichtiger nimmt als das Bild, ist weitgehend verloren gegangen. Die Themen-Passagen zu Literatur, Klang, Street-Art, Comics etc. sind ein Angebot, um das Gehen und Rezipieren im Gehen wieder mehr zu betonen.“
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Viennafair: Wiens beste Kunstmesse der Stadt

Von Kunst als Investment wird hier heuer fast peinlich berührt nicht mehr geredet. Die Qualität wurde gehalten, einige neue Ansätze wirken aber noch nicht ausgereift.
(Die Presse)
Liebes Geld, tut mir leid, dass ich dich so lange gehasst habe. Ich liebe dich. Bitte, bitte komm zu mir zurück.“ Schreibt Marina Albu, 1984 geborene rumänische Künstlerin auf einer Kojenwand der Viennafair. Und was ist eine Kunstmesse schon anderes als ein ironischer Liebesbrief – der Kunst an das Geld, das sie so verachtet und sie doch erst ermöglicht. Der Künstler an ihre Sammler, verkuppelt durch die Galeristen. So gesehen ist Wien diese Woche ein Liebesnest.
Im Dunstkreis der auf Kunst aus Österreich, Russland und Osteuropa spezialisierten Kunstmesse brodelt es: 20 führende Wiener Galerien eröffnen heute in ihren Stammräumen zusätzlich zur Viennafair das ambitionierte „Curated by“-Programm. In den heruntergekommenen Räumen des ehem. Post- und Telegrafenamts neben der Börse breitet sich die Satellitenmesse Parallel aus – Shabby Chic mit wenigen künstlerischen Höhepunkten. Und vor der Karlskirche materialisiert sich die junge Szene genau gegenteilig: auf einer strahlend weißen, riesigen Kuppel, bisher nur von Promotion-Events bekannt.
Kurator Jürgen Weishäupl bespielt diese „I-Sphere“ erstmals mit Kunst, projiziert auf ihre Haut Videos. In Kooperation mit den Wiener Galerien Bäckerstraße 4 und Viertel Neun, beide anscheinend vom Viennafair-Beirat nicht erwünscht. Doch man schmollt nicht, sondern stellt selbst etwas auf die Beine– rund um den Video-Dome gibt es noch Einzelpräsentationen in Containern.
Unerwünschte Container gehen der Viennafair auch stärker an den Kragen: Am Rande des Messevorplatzes steht ein doppelt unbequemer, den der galerienlose Künstler Bernhard Hammer mit einer interaktiven Installation zur Flüchtlingsthematik bespielt. Fast schon eine pathetische Symbolik hier, vor dem VIP-Transitbereich der Viennafair. Wobei die Umarmung der Off-Szene durch die „Reiche-Russen-Messe“ wohl durchaus großzügiger ausfallen würde. Würden im Hintergrund nicht die üblichen Galeristenmachtspiele ablaufen. Trotzdem, die Viennafair hat sich als Herzstück des Wiener Kunstmarktplatzes etabliert.
Das hat auch die endgültige Machtübernahme durch den russischen Immobilienentwickler Dmitry Aksenov nicht geändert, der bereits voriges Jahr stiller Eigner war und sich erst unlängst von Partner Sergey Skaterschikov trennte. Die Messe wird jetzt zu 70 Prozent von Aksenov und zu 30 Prozent von der bekannten Wiener Gruppe von Sammlern und Mäzenen gehalten. Mit Skaterschikov scheint es noch offene Rechnungen zu geben, Aksenov erklärte bei der Viennafair-Pressekonferenz den von Skaterschikov gegründeten Ankaufsfonds, der 2012 rund 600.000€ auf der Messe investiert hat, für ruhend. Bis die Besitzansprüche an den Werken geklärt sind, was bis Jahresende passieren soll, so Aksenov.
Das voriges Jahr so strapazierte Wort Investment fiel jedenfalls heuer kein einziges Mal auf dem Podium, auf dem auch die künstlerischen Leiterinnen, Vita Zaman und Christina Steinbrecher-Pfandt, sowie Vertreterinnen der Hauptsponsoren Erste Bank und OMV saßen. Im Großen und Ganzen ist diesem Team wieder eine hochkarätige Veranstaltung gelungen. Bis auf einige Unausgereiftheiten, etwa die zu versteckte und unklar beschriftete Wand mit günstiger Kunst für Start-up-Sammler. Die an den nahen Prater erinnernde riesige Tony-Soprano-Statue im Zentrum der Messe. Und den verschwindend kleinteiligen Skulpturengarten auf dem Messevorplatz. Man merkt schon die Schwierigkeit des Spagats zwischen Spektakelkunst und Kunstspektakel, zwischen der berechtigten Sehnsucht nach der Messe als Event und der Gefahr, hinter der Oberfläche zu ersticken.
Heimtückische Superlative der Kunst!
Trophy-Art findet man hier zumindest keine, internationale High-End-Galerien verzichten schnöde auf den Standort Wien. Trotzdem legen sich die international arbeitenden österreichischen Galerien ins Zeug: Altnöder widmet dem jungen Performer Peter Fritzenwallner einen prominenten Zone-1-Entdeckungsstand, genauso wie Hilger den zauberhaften, zeitgenössisch gebrochenen historischen Stichen Andrew Mezwinskys, der bald im Jüdischen Museum ausstellt. Nächst St. Stephan leistet sich einen konzeptuell gefinkelten Programmüberblick, Kargl stellt einen ganzen Raum aus, den David Maljkovic für einen Wiener Sammler konzipiert hat. Meyer Kainer bietet eine Art Rückschau auf Teile des heurigen Wiener Museumsprogramms – mit einem Abguss aus der Gelatin-Installation im 21er-Haus, Modellen Franz Wests oder einer Collage aus Verena Denglers MAK-Ausstellung – „Wiener Geflecht“. Toller Titel.
Hubert Winter scheint ein Abo auf den Wirtschaftskammerpreis für die beste Schau einer etablierten Galerie zu haben, er gewinnt ihn das dritte Mal in Reihe – für die Präsentation der Grafitzeichnungen des wenig bekannten Franz Vana. Über den Preis für eine junge Galerie, der an die polnische Galerie Czulosc geht, könnte man streiten.
Prinzipiell aber darf man sich wieder auf diese Messe freuen. Mit Superlativen aber, das hat uns das Viennafair-Plakat heuer heimtückisch gelehrt, sollte man vorsichtig sein: „Österreichs größte Kunstmesse Europas.“ Versäumen Sie sie trotzdem nicht.
Bis 13.10., Messeplatz 1, Wien 2, www.viennafair.at
(„Die Presse“, Print-Ausgabe, 10.10.2013)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
› Kultur › Kunst › Viennafair
Junge Kunst ist Nummer Eins

In der ZONE1 bietet die VIENNAFAIR The New Contemporary Sonderpräsentationen vorwiegend junger, österreichischer KünstlerInnen
(Advertorial)
Eine besondere Möglichkeit, das Werk von ausgewählten KünstlerInnen besser kennenzulernen, bietet auch dieses Jahr die ZONE1. Das BM:UKK Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur unterstützt dabei auch dieses Jahr die teilnehmenden jungen KünstlerInnen aus Österreich.
Sie wollen sehen, wie man Ludwig Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus Stück für Stück auseinandernimmt und wieder neu zusammensetzen kann? Dann kommen Sie in die ZONE1 auf der VIENNAFAIR The New Contemporary. Die Galerie Mario Mauroner Conteporary Art gibt dem 1977 geborenen österreichischen Künstler Jochen Höller die Möglichkeit, seinen „Wittgenstein-Generator“ zu präsentieren, eine Maschine, mit der man neue Behauptungen zur Welt und allem was der Fall ist aufstellen kann.
Sie ist eine wirklich begnadete Zeichnerin, die 1978 in Sofia, Bulgarien geborene Sevda Chkoutova. Wie Collagen wirken ihre großformatigen, aus fotorealistischen und abstrakten Elementen zusammengesetzten Kunstwerke die der Projektraum Viktor Bucher in der ZONE1 präsentiert.
Ebenfalls aus Bulgarien stammt der 1981 geborene Nestor Kovachev. Mit humorvollem, frischen Blick nimmt er unsere westliche Gesellschaft ins Visier und vergleicht sie mit den Lebensweisen seiner Heimat. Das Ergebnis sind Werke die sowohl klassische Techniken aus Malerei und Zeichnung mit zeitgenössischen Bildsprachen kombinieren. Zu sehen im Stand der Galerie Heike Curtze in der ZONE1.
Für Tomas Eller (1975 geboren in Meran, Italien) sind Video und Fotografie die bevorzugten Medien. Oft kombiniert er auch seine Fotos mit collagierten Elementen die eine faszinierende Erweiterung seiner Themen darstellen. Die auf Fotografie spezialisierte Galerie Ostlicht zeigt Eller an ihrem Stand in der ZONE1.
Peter Fritzenwallner ist eigentlich ein Spezialist für Performance und hat dafür gerade erst den H13 Preis für Performance des Kunstraum Niederoesterreich bekommen. In seiner Installation für die ZONE1 zeigt ihn die Galerie Altnöder mit einer ebenso feinsinnigen wie hintergründigen Persiflage auf das Vademecum der intellektuellen Welt: das Reclam Büchlein
Die seit 1978 in Wien lebende Rini Tandon wurde in Raipur, Indien, geboren. Besonders mit ihren Skulpturen gehört zu den bedeutendsten in Österreich lebenden KünstlerInnen ihrer Generation. Die Galerie Raum mit Licht zeigt in der ZONE1 ihre großformatigen amorphen Objekte die mit Material, Form und oft glänzenden Farben spielen. Sie erwecken den Eindruck, als würden sie nur von einer unsichtbaren Energie zusammengehalten und sich jeden Moment auflösen und zerfließen.
Roter Samt ist das künstlerische Material der 1964 geborenen Künstlerin Gudrun Kampl, die bei der Grand Dame der österreichischen Kunst, Maria Lassnig studiert hat. Eros und Thanatos, Lust und Abscheu verbindet sie zu barocken Skulpturen und Installationen die sicher am Stand der Galerie Steinek in der ZONE1 ein begeistertes Publikum finden werden.
Kunst als eine Partie Schach, nur ohne Würfel. So könnte man die Arbeitsweise des 1983 in Bregenz geborenen Albért Bernàrd bezeichnen. Bei der Galerie Lisi Hämmerle wird er in der ZONE1 wiederum darangehen, nicht nur den herkömmlichen Begriff von Skulptur zu erweitern, sondern sich gleich an Raum, Zeit und Wahrnehmung versuchen.
Der amerikanische Künstler Andrew M. Mezvinsky, geboren 1982 in Philadelphia, zählt zu den interessantesten jungen Künstlern, die derzeit in Wien arbeiten. Mit theatralischen Installationen erweitert er den klassischen Begriff von Malerei und Zeichnung, bezieht sich auf Architektur ebenso wie auf das anwesende Publikum. Am ZONE1-Stand der Galerie Ernst Hilger kann man sich davon überzeugen und inspirieren lassen.
Die 1979 in Wien geborene Künstlerin Sofia Goscinski arbeitet in verschiedensten künstlerischen Medien, von Grafik, Text, Video, Foto bis hin zu Installationen und Performances. Sie setzt sich mit mentalen Störungen, Schmerz und Lust auseinander. Die Galerie Zimmermann-Kratochwill präsentiert Goscinskis Kunst wider die Harmlosigkeit in der ZONE1.
Im Rahmen des Programms VIENNA Gold führen vier KünstlerInnen aus der ZONE1 durch ihre Präsentationen und eröffnen damit die Möglichkeit, ihre Kunstwerke noch näher kennen zu lernen.
Die Termine:
10. Oktober 2013, 16 Uhr: Nestor Kovachev
11. Oktober 2013, 16 Uhr: Jochen Höller
12. Oktober 2013, 16 Uhr: Peter Fritzenwallner
13. Oktober 2013, 16 Uhr: Rini Tandon
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
› Kultur › Kunst
08.04.2010 | 18:24 | ALMUTH SPIEGLER (Die Presse)
Ein Swingerclub wird Kunst – wird Kunst im Swingerclub zu Porno? Nein, zeigen junge Künstler. Sie nutzen die leer stehenden Originalräume spontan für eine Gruppenausstellung.
Bitte nicht vergessen, die Türe zu schließen“, erinnert eine Lautsprecherstimme im leicht schaurigen Niemandsland zwischen den beiden Eingangstüren des Swingerclubs „Element 6“ höflich an die prekäre Schleuse zwischen intim und öffentlich, die man hier betritt. Eine ungewohnte Begrüßung für einen Ausstellungsraum – und der erste (von gar nicht so vielen) Unterschieden zum Swingerclub-Nachbau in der Secession. Dort residiert „Element 6“ ja noch bis 18.April, mutiert zur nächtlich bespielten Skandalinstallation, durch die eine so heftig umstrittene wie praktizierte Spielart der Sexualität samt ihren Attributen temporär zu Kunst wird.
Im Gegenzug dazu nutzt eine Gruppe Studierender der Angewandten die leer stehenden Originalräume spontan für eine Gruppenausstellung: Drei Tage lang testen die jungen Künstler, wie sich eigene sowie eingeladene Werke in diesem Umfeld benehmen. Ziemlich unanständig, muss man sagen. Jeder Turm wird hier zum Phallus – sei er aus bunten Kinderbauklötzen wie der von Peter Fritzenwallner auf einem niederen Couchtisch aufgebaute oder aus schwarz lackiertem Styropor, wie das kristalline Riesending, das Herbert de Colle und Hannes Ribarits hinter die Bar gestellt haben. Im plüschigen Ambiente wird das abstrakte Teil zur aggressiv sexuellen männlichen Barmaid. Dieser Ort ist eben keiner „für Sublimierungsversuche“, wie es die Studierenden formulieren. Sondern eine Herausforderung: etwa für Siggi Hofers immerhin schwer lesbare Buchstabenkulisse. Der Schriftzug „Leer geblasen“ bekommt auf der kleinen, verlassenen Showbühne mit Stange eben eine durchaus andere Bedeutung, als er sie 2006 im luftigen Obergeschoß des Strabag-Hochhauses hatte.
Auch die Duschen und Kojen werden bespielt: In einer der Sexzonen etwa wartet ein körperlich schwer herausgefordertes Kuscheltier der Gelitins. In einer anderen Markus Proscheks „Fantom“, eine fetischhafte Stele mit Bienenkorbkopf, der für entindividualisierte Kollektive steht. Daneben Bernhard Hosas abnorme Porträts abnormer Rechtsbrecher. Davor Ines Hochgerners Gemälde von Freuds Couch ohne Teppich drüber – was einen seltsam schweißbefleckten Bezug preisgibt. Hier erinnert man sich auch an den Titel dieser so aktuellen wie unaufgeregten Initiative – der Umkehrung eines Freud-Zitats: „Wo Ich war, soll Es werden“.
Bis 11.April, Eröffnung heute, Fr., 19 h, Sa. 16–22 h, So. ab 17 h. Kaiserstr. 95, Wien 7.
(„Die Presse“, Print-Ausgabe, 09.04.2010)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ausstellung: Geistesblitze im Kunstnebel
03.11.2009 | 18:47 | ALMUTH SPIEGLER (Die Presse)
In der Secession und im „Weißen Haus“ warten Schwärme von Elektronen, um uns auch heute davon zu überzeugen: „Es lebe die Maschinenkunst!“
Kalte, feuchte Luft weht einem entgegen, der Raum ist düster, in der Mitte prangt eine mächtige, wummernde Maschine, die aussieht, als hätte Bruno Gironcoli sich in russischen Forschungslabors ausgetobt und nicht in österreichischen Skulpturenparks. Es wird einem aber rasch klamm ums Herz: Aus den beiden großen Tellern der Maschine steigen zwei Säulen Wasserdampf auf, hellgraue Wolken, die sich dräuend-romantisch in Richtung der Oberlichte der Secession verziehen und alle zehn Minuten von einem massigen Industrieventilator auf den Karlsplatz geschaufelt werden. Elektrosmog. Wenn sie immer schon einmal wissen wollten, wie dieser aussieht – voilà!
Die junge italienische Künstlerin Micol Assaël lädt hier Wasserdampf mit 10.000 Volt auf und erzeugt dadurch ein sichtbares elektrostatisches Feld. Ist man über acht Jahre alt, nicht schwanger und trägt keinen Herzschrittmacher darf man dieses auch durchschreiten – von groben elektrischen Schocks kann nicht berichtet werden, die Haare stehen einem auch nicht gleich zu Berge, nur die Härchen im Gesicht beginnen sich aufzurichten, was höchstens ein angenehmes Kribbeln erzeugt.
Ungläubiger kleiner Technik-Thomas
Trotzdem. Ganz wohl ist einem nicht bei diesem Ausstellungsbesuch und zwar nicht nur, weil man an die Stromrechnung des Künstlervereins denkt (sie ist in diesem Fall Teil des Ausstellungsbudgets). Aber Strom plötzlich „sehen“ zu können! Und derart mächtigen Maschinen auf Augenhöhe gegenüberzustehen! Das ist der Generation Wlan seelisch nur noch zumutbar, wenn sie das Glück hat, sich gerade noch an einen Physikunterricht erinnern zu können, bei dem Energie noch durch simple Reibung auf einer drehbaren alten Funkenschleuder aufgeblitzt ist. Danke, Frau Fessor! Sonst wäre ich heute ein ungläubiges Thomasinchen und müsste die Maschine – streng verboten! – betatschen, wie der Hl. Thomas Jesus‘ Wunde, um glauben zu können.
Technikgläubigkeit, daran spielt wohl der Titel der Installation an, „Fomuska“, auf Russisch kleiner Thomas. Das ungläubige Staunen und die russische Maschinenkunst, die Wladimir Tatlin Anfang des 20. Jahrhunderts begründete, das bringt Micol Assaël heute, in einer Zeit ohne Utopien, in ihren Versuchsanordnungen zusammen, zeichnet dabei auch durch ihre Herkunft eine historische Spur nach. Stand doch die russische Avantgarde in Beziehung zum italienischen Futurismus, und arbeitet die Italienerin Assaël doch eng mit dem Moskauer Elektroenergetischen Institut zusammen.
So geht „Fomuska“ etwa auf eine russische Versuchsanlage zurück, in der die Blitzentladung simuliert wurde. Würde man etwa eine Neonröhre in den extremen Elektrosmog halten, begänne diese zu „blitzen“.
Kleine elektrische Schläge
Ausprobieren kann das, wer sich traut, im Wiener Kunstverein „Das weiße Haus“, wo David Moises und Chris Janka einen „Geistesblitzgenerator“ zur großzügigen Verfügung stellen: Einen Hometrainer, der über eine Apparatur wie in einem Lift Elektronen nach oben, in eine auf Kopfhöhe des Fahrers montierte metallene Kugel schickt, erklärt Moises. „Und dann wollen die Elektronen eben aussteigen.“
Was man daran erkennt, dass die Neonröhre leuchtet, die man in Richtung Kugel halten kann. Oder spürt, wenn einen der „Geistesblitz“ trifft, manchmal unerwartet heftig, handelt es sich immerhin um eine, vor allem im Vergleich mit „Fomuska“ hohe Spannung, 700 Kilovolt – „das Rad wehrt sich eben gegen seine Benutzung“, meint Moises. Am Samstag erklärt er dieses Eigenleben der Maschine in einer Lecture noch ein wenig genauer. Zehn jüngere Künstler, vor allem Jungs, wurden vom jungen Kunstverein eingeladen, ihre „Funky Machines“ zu zeigen. Ein Trend? Heißt es etwa immer noch, wie 1920 bei der ersten Dada-Messe „Die Kunst ist tot. Es lebe die neue Maschinenkunst Tatlins“? „Von 300 Einreichungen für unser Jahresprogramm fiel uns dieses Thema eben auf“, ist sich Elsy Lahner nicht ganz trendsicher. Maschinenkunst, Kinetik, Bricolage, also Bastelkunst, haben nun einmal eine lange, ungebrochene Geschichte, die von Leonardo an erzählt werden könnte und mit Tatlin und Tinguely in der Moderne Höhepunkte hatte.
Was sich allerdings sowohl in der Secession als auch im „Weißen Haus“ durchzieht, da eben sowjetische Rohheit, dort eher Ikea-Sperrigkeit, ist die Bastelästhetik, die zum Teil kongenial, zum Teil verschroben ist: Achim Stiermanns raumhohe Maschine aus Strohhalmen etwa, die Tischtennisbälle in einen unerwarteten Kreislauf bringt, der über eine schräge Platte, den Parkettboden und einen aufgespannten Regenschirm führt. Oder Peter Fritzenwallners Hochsitz, der über Seile die Bewegungen des Sitzenden zur Musik, etwa YMCA, auf eine Art „Schießscheibe“, ein Diagramm überträgt. Bewusst unperfekt auch die unebenen Keramikkugeln von Korinna Lindinger, die den Raum erforschen, sich selbstständig von einer Wand zur anderen wuchten, aneinanderprallen, aber bisher doch nicht zerschellten. Spielerisch, poetisch und erfindungsreich. Unbedingt ansehen. Bis Samstag noch. Danach folgen zwei Einzelausstellungen, von Bernhard Hosa und Zweintopf. Und im April zieht das „Weiße Haus“ dann weiter, in ungewisse Weiten.
(„Die Presse“, Print-Ausgabe, 04.11.2009)

